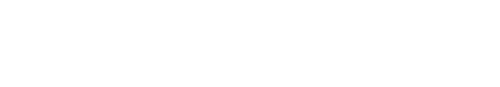18415085
Denken II
Description
No tags specified
Flashcards by Marina Kasper, updated more than 1 year ago
More
Less
|
|
Created by Marina Kasper
over 5 years ago
|
|
Resource summary
| Question | Answer |
| Definition Problemlösen | - Beseitigen eines Hindernisses oder Schließen einer Lücke in einem Handlungsplan durch bewusste kognitive Aktivitäten, die das Erreichen eines beabsichtigten Ziels möglich machen soll - keine Routine verfügbar - Ziele und Hindernisse als Bestandteile des Problemlösens - Motivation und Emotion als Komponenten (high-stake und low-stake-problems) |
| Die Wichtigkeit von Zielen bei der Problemlösung | - Ziele als vorweggenommene Handlungsfolgen, die zu zielführenden Handlungen motivieren und eine Bewertung von Handlungsergebnissen im Lichte der Erwartungen erlauben - ohne Ziele kommt es nicht zu Handlungen, sondern allenfalls zu Erwartungen - hilfreiche Ordnungsprinzipien - bei komplexen Problemen liegen mehrere Ziele gleichzeitig vor (Polytelie) - bei der Polytelie sind zwei Ziele miteinander unvereinbar oder ein Ziel unterstützt ein anderes Ziel oder zwei Ziele sind gleichzeitig vorhanden, aber dennoch unabhängig voneinander - kontinuierliche Adjustierung von Zielen |
| Das Rubikon-Modell der Handlungsphasen | 1. Abwägung zwischen Wünschbarkeit und Realisierbarkeit, Intentionsbildung, Fazittendenz 2. Ausrichtung aller Aktivitäten auf die Realisierung des ausgewählten Ziels, Commitment (Volitionsstärke) spiegelt die Fiattendez wider, Phase gekennzeichnet durch Planungsaktivitäten 3. Realisierung der Handlung, es wird gehandelt 4. Konzentration auf das Ergebnis der Handlung, Evaluation der Zielerreichung |
| Die Phasen des Problemlösens | 1. Problemidentifikation 2a. Zielanalyse: Klärung des zu erreichenden Zielzustands 2b. Situationsanalyse: Bestandsaufnahme, Überprüfung des Konflikts und des Materials 3. Lösungsplanung: Abfolgen und Randbedingungen erkennen, Zwischenziele bilden, Verfügbarkeit von Alternativen, Angemessenheit der Auflösung, Planerstellung nutzt Skripte aus dem Langzeitgedächtnis 4. Planausführung und -überwachung 5. Evaluation, Bewertung von Teilzielen |
| Weitere Phasenmodelle | - IDEAL (Identifikation-Definition-Erzeugen von Alternativen-Abwägen-Loslegen) - nach Lipshitz und Bar-Ilan: Identifikation-Definition-Diagnose-Erzeugen von Alternativen-Evaluieren von Alternativen-Wahl und Handlung |
| Wohl definierte und schlecht definierte Probleme | - wohl definiert: klar umrissene Ausgangs- und Zielbedingungen, bekannte Mittel, Akteur weiß genau, wann das Problem gelöst ist - schlecht definiert: der Akteur weiß weder, worin genau das Problem besteht, noch kann er angeben, wann das Problem gelöst ist |
| Problemlöse-Strategien „Versuch und Irrtum“ und „Heuristiken verwenden“ im Vergleich | - „Versuch und Irrtum“: Ausprobieren von verschiedenen Lösungsentwürfen - „Heuristiken“: spezielle Strategien, die Lösungen finden sollen, wenn es keinen Algorithmus gibt oder dessen Anwendung zu aufwändig erscheint, Daumenregeln |
| Definition Einsicht | - plötzlich und unerwartet im Bewusstsein auftauchende Lösung eines lange ungelöst gebliebenen Problems - drei Dimensionen: Phänomenal-, Aufgaben-, Prozessdimension |
| Einstellungseffekt | - liegt vor, wenn bei einer Serie ähnlicher Problemen ein bestimmtes Lösungsmuster zur Routine wird und selbst dann ausgeführt wird, wenn es einfachere (kürzere) Lösungswege gibt |
| analoges Problemlösen | - Nutzen von Erfahrungen durch Übertragen der Prinzipien aus einem Bereich (Quelldomäne) auf einen anderen Bereich (Zieldomäne) |
| Problemlöseprozess bei Experten | - Verwendung einer Vorwärtsstrategie, sodass sie ihr umfangreiches Fall- und Hintergrundwissen auf ein gegebenes Problem anwenden - orientieren an der Tiefenstruktur eines Problems - lösen nur schneller, wenn sie dazu aufgefordert werden - genauer, sofern es nicht um Entscheidungen unter Unsicherheit geht - keine Strategieunterschiede (nur im Übergangsstadium) - besser ausgeprägte metakognitive Fähigkeiten - andere Wissensstrukturen im semantischen Gedächtnis, vor allem in den Assoziationen zwischen Konzepten - größeres episodisches Gedächtnis, solange der Wissensvorteil nicht wegfällt |
| Problemlöseprozess bei Novizen | - langsamere Aufgabenlösung, wenn Experten dazu aufgefordert werden - ungenauer, außer bei Entscheidungen unter Unsicherheit - Orientierung an oberflächlichen Merkmalen |
| Aspekt des Problemlösens, der bei der "Notfallreaktion des kognitiven Systems" illustriert wird | - genetisch vorgegebene Reaktion auf unspezifische Gefahrensituationen und ihr Zweck ist die Herstellung einer Bereitschaft für schnelle und allgemeine Reaktionen - neben einer allgemeinen Aktivierung erfolgt eine Externalisierung der Verhaltenssteuerung und eine Voraktivierung allgemeiner, d.h. von keinen oder wenigen spezifischen Bedingungen abhängige Verhaltensweisen - Problemlösen nicht nur Kognition, sondern auch Motivation und Emotion (Senkung des intellektuellen Niveaus, Tendenz zu schnellem Handeln, Degeneration der Hypothesenbildung) |
| Prinzipien der Theorie unbewusster Gedanken | - bewusstes Denken ist aufmerksamkeitsgeleitet und kapazitätsbeschränkt; unbewusstes Denken erfolgt ohne Aufmerksamkeit mit mehr Ressourcen 1. Prinzip unbewusster Gedanken: Denken erfolgt bewusst und unbewusst 2. Kapazitätsprinzip: bewusstes Denken unterliegt Kapazitätsbeschränkungen, unbewusstes nicht 3. Aufwärts-versus-Abwärts-Prinzip: unbewusstes Denken operiert "Bottom Up", bewusstes Denken "Top Down" 4. Gewichtungsprinzip: unbewusstes Denken führt zu einer natürlichen Gewichtung der relativen Bedeutung verschiedener Attribute, während bewusstes Denken diesen Prozess stört (außer bei Regelprinzip) 5. Regelprinzip: bewusstes Denken kann Regeln folgen und ist präzise, unbewusstes Denken liefert grobe Schätzungen 6. Konvergenz-versus-Divergenz-Prinzip: bewusstes Denken erfolgt fokussiert und konvergent, unbewusstes Denken divergent |
| Methoden der Erfassung von verbalen Daten | - lautes Denken führt zu einer Verlangsamung des Denkprozesses, nicht zu einer Störung - zusätzliche Datenquellen: Reaktionszeiten, Fehlerraten, Blickbewegungsmuster oder Hirnaktivität |
| Methoden der Erfassung von Verhaltendaten | drei Arten von Verhaltensäußerungen: - sequenzielle Problemstellungen: Lösungsweg zwischen Ausgangs- und Zielsituation durch eine Reihe von Zwischenzuständen sichtbar machen in einem definierten Problemraum - computersimulierte Probleme: kausale Modelle erstellen aufgrund der Vernetztheit, zeitliche Entwicklungsverläufe antizipieren aufgrund der Dynamik - Blickbewegungsmessung: Reaktions- und Entscheidungszeitmessungen, pupillometrische Daten |
| Methoden der Erfassung von physiologienahen Daten | - funktionelle Verfahren: Positronenemissionstomographie, Magnetresonanztomographie (fMRT) |
Want to create your own Flashcards for free with GoConqr? Learn more.